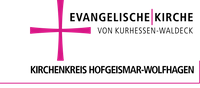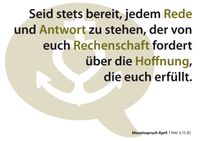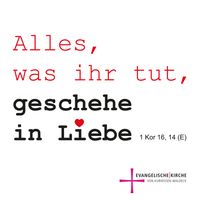Zum Weiterdenken
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die Texte zur Verfügung, die - zumeist - aus der Mitte unseres Kirchenkreises für die Hofgeismarer Allgemeine und die Wolfhager Allgemeine erstellt werden - zum Nachlesen, Nachdenken und Weiterdenken.
27. April
Ich bin bei dir
Von Prädikant Günther Dreisbach
Am kommenden Mittwoch beginnt Jan Friedrich Eisenberg seinen Dienst als Dekan im Kirchenkreis Hofgeismar-Wolfhagen. Am Sonntag Rogate, am 5. Mai, wird er in sein Amt eingeführt. Das ist ein Festtag für die Gemeinden von Arenborn im hohen Norden bis Altendorf im Süden, von Oedelsheim im Osten bis Viesebeck im Westen.
Wenn er am Mittwoch seinen Dienst beginnt, steht im Losungsbuch der Herrnhuter Brüdergemeinde, einer täglichen Glaubensration für die Christenheit, ein Wort aus dem Buch des Propheten Jeremia: »Ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe.« Darauf wird sich der neue Dekan verlassen. Das wird ihm Kraft geben für alles, was in dem neuen Amt auf ihn zukommt. Manche werden sagen: Das ist ein schöner Zufall, dass das am ersten Diensttag des Dekans im Losungsbuch steht. Mag sein. Aber Albert Schweitzer hat einmal gesagt: »Zufall, das ist das Augenzwinkern des lieben Gottes.« Und ich kann mir vorstellen, dass Dekan Eisenberg das genau so sieht.
Und dann: Die Einführung ist am Sonntag Rogate. Auch das mag Zufall sein. Aber der Sonntag Rogate (»Betet!«) ist für die evangelischen Christen der Sonntag, an dem besonders an das Beten gedacht wird. Und da ist es eine schöne Aufgabe, sich vorzunehmen, den Dekan regelmäßig ins Gebet zu nehmen, was heißt: für ihn zu beten. Das und die Gewissheit, dass Gott ihm hilft, wird ihn zuversichtlich seinen Dienst tun lassen.
Übrigens: Der erste Diensttag ist der 1. Mai. Da kann man das in Escheberg entstandene Lied umdichten: »Der Dekan ist gekommen!« Und: Gott ist bei ihm, dass er ihm hilft. Was will er mehr?
20. April
Gedanken zum Sonntag:
Erst einmal zuhören
Von Pfarrer Martin Schöppe
Die Texte der christlichen Bibel beschreiben die Person des Jesus von Nazareth als jemand, der zunächst zuhört, wenn er mit Menschen in Kontakt kommt. "Was willst du, dass ich dir tue?" Das ist oft seine Frage, um eine Begegnung zu eröffnen. Er möchte zunächst verstehen in welcher Situation ein Mensch ist und was ihn bewegt. So kann ein wirklich bereichernder Austausch stattfinden.
Dann erst beginnt das, was die Bibel als neues Leben oder auch Heilung des Menschen beschreibt. Im Mittelalter bringt der Gelehrte Thomas von Aquin eine wissenschaftliche Methode zur Perfektion, die ähnlich funktioniert. Bevor die eigenen Argumente vorgetragen werden, muss erst nachgewiesen werden, dass die Position des Dialogpartners richtig verstanden wurde. Dann erst wird die eigene Position vorgetragen und es kann zu einem Austausch kommen, der im besten Fall beide weiter und zu einem Ergebnis führt.
Zuhören, um den anderen besser zu verstehen ist auch in der aktuellen Situation der Gesellschaft wichtig, damit Auseinandersetzung und Streit im demokratischen Ringen zu einem Ergebnis führen, das möglichst viele Menschen mitnimmt. Erst einmal zuhören, um den anderen und sich selber besser zu verstehen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von wirklicher Stärke.
Gerade weil gelebte Demokratie keine Harmonieveranstaltung ist, braucht es diese Stärke. Gerade weil in unserer Gesellschaft und den menschlichen Beziehungen schon zu viel kaputt gegangen ist, wird es Zeit sich daran zu erinnern.
Glaubenssache:
Ruhe im Baum
Von Pfarrer Kai Michael Scheiding
Es wird stiller in Feld und Flur: Laut einer Studie des NABU sind seit 1980 etwa 600 Millionen Singvögel in der EU verschwunden. Betroffen sind vor allem Arten in Feldern und Gärten. Ein Grund: weniger Insekten. Grund dafür wiederum sind effektivere Insektenvertilgungsmittel in der Landwirtschaft und: überpflegte Gärten.
Ein schöner Garten besteht nach althergebrachter Meinung oft aus Blumenrabatten, die zwar imposant, aber häufig ohne Nährwert sind; dazwischen sauber geharkte Erde, akkurat gestutzte Hecken und millimeterkurz getrimmtem Rasen. Wo es anders aussah, galt ein Grundstück als „verkommen“.
Aber ist diese Ästhetik noch zeitgemäß? Ist das „der schönen Gärten Zier“, die Paul Gerhardt einst in seinem Sommerlied besang? Der Wissenschafts-Journalist Dirk Steffens bezeichnet solche Rasenflächen als „degeneriert und ökologisch tot“. Dort kann nichts krabbeln, summen oder brummen. Und in der Folge in den Bäumen nichts singen, zwitschern und tirilieren.
Noch ist der „stille Frühling“ nicht Realität. Aber vielleicht ist es Zeit zum Umdenken; für eine neue, andere Garten-Ästhetik. „Der schönen Gärten Zier“ kann auch das pralle Leben in ihnen sein, das im Gras summt und brummt, im Laub des Vorherbstes raschelt und singende Vögel, die dort reichlich Nahrung finden und Nester bauen. Viele Kommunen haben (wenn auch aus Geldnot) schon reagiert und lassen im Sommer das Gras auf manchen öffentlichen Flächen hochwachsen. Schöpfungsbewahrung und weniger Arbeit in einem. Unsere Gärten sollen nicht verwildern! Aber eine gezähmte Wildnis hilft, dass es nicht still wird in ihnen.
13. April
Gedanken zum Sonntag:
„Richtet nicht, …“
Von Pfarrer Achim Wittenberg
„… damit ihr nicht gerichtet werdet,“ ruft Jesus uns in der Bergpredigt zu. Diese Forderung erwächst aus einer Einsicht: Aller Schuld anderer Menschen liegen Bedürfnisse zugrunde, die auch ich teile. Luther macht aus Jesu Forderung die wohl machbarere „Trennung von Person und Werk“, d. h. „Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde“.
Oder wie es einer meiner Professoren im Studium formulierte: „Gott liebt den Menschen unabhängig von seinen Taten und Eigenschaften. Denn erst durch die Liebe Gottes kann der Mensch (positive) Eigenschaften entwickeln und Taten leisten.“ Das ist eine tiefe Grundwahrheit unseres Lebens: Nur wo wir uns geliebt und angenommen fühlen, sind wir in der Lage wirklich liebevoll zu handeln und unsere Fähigkeiten zu entfalten. Und es ist ein probates Mittel zum Umgang mit Konflikten, das ebenfalls von Jesus empfohlen wird.
Nur wo mein Gegenüber wieder in ein entspanntes Vertrauen finden kann, wird es bereit sein, sich auf meine Sicht des Konflikts einzulassen. Um ein solches Vertrauen im Konflikt schenken zu können, brauche ich selbst eine große Geborgenheit, die ich persönlich nur durch regelmäßiges Gebet finde. Das ist sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe, aber eine, die sich lohnt.
Glaubenssache:
Der Ginkgo
Von Pfarrerin Kathrin Wittich-Jung
In unserem Garten steht ein Ginkgo-Baum.
Wahrscheinlich wurde er vor 20 oder 30 Jahren gepflanzt. Da haben wir noch nicht in dem Haus gewohnt. Ich freue mich immer wieder an diesem Baum.
Gerade gewachsen steht er da und spendet Schatten, wenn wir auf der Terrasse sitzen.
Er braucht im Frühjahr von allen Bäumen am längsten, bis seine Blätter sprießen. Zart und vorsichtig kommen die Blätter dann aus den Knospen.
Ein Ginkgo im Garten steht für Frieden und Freundschaft.
Er steht auch für Hoffnung:
Als 1945 die Atombombe über Hiroshima fällt, wird alles zerstört.
Auch der Ginkgo vor dem Kloster geht in Flammen auf. Alles Leben ist erloschen.
Da war keine Hoffnung, dass in dem atomar verseuchten Gebiet je wieder Leben sein würde.
Aber der Ginkgo trotzte dem. Elf Jahre später passierte ein kleines Wunder: Er trieb im Frühjahr wieder aus und neue Blätter kamen vorsichtig aus den Knospen. Das Leben hat gesiegt. Und neue Hoffnung hat Einzug gehalten. Trotz allem lebt er weiter und das lässt ihn für viele Menschen zu einem Symbol für Hoffnung werden.
Gerade in diesen Zeiten, in denen jeden Tag neue Nachrichten vom Krieg kommen, wo die eigene Zukunft vielleicht ungewiss ist, da brauche ich Hoffnung und einen Ort, an dem ich meine Sorgen ablegen kann. Im Glauben finde ich Hoffnung. Das heißt nämlich, mich nicht der Mutlosigkeit hinzugeben. Im Glauben finde ich die Kraft und den Mut, das Leben trotz allem anzugehen – auch wenn die Nachrichten erdrückend sind.
Und manchmal braucht es den Ginkgo im Garten, das nicht zu vergessen: „Es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft.“ (Jeremia 31,17)
6. April
Gedanken zum Sonntag:
Kaum zu glauben?!
Von Pfarrer Sven Wollert
Doch! Über ihn wird gesprochen: Thomas. Unter den Jüngern von Jesus spielt er eigentlich eine etwas unrühmliche Rolle. Sie hätte das Zeug dazu, aus Thomas den peinlichen Verwandten zu machen, den man lieber verschweigt.
Denn Thomas ist kein Vorbild in Sachen Glauben. Alle erzählen ihm, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen haben. Voller Begeisterung erzählen sie ihm nach Ostern von dem fast Unglaublichen. Und Thomas? Er glaubt es nicht. Nicht den Jüngern, nicht den Frauen, die am Grab waren.
Ein leeres Grab kann viele Gründe haben. Deshalb will Thomas Beweise, handfeste Beweise, um seine Zweifel zu überwinden: "Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich’s nicht glauben."
Warum erzählt die Bibel von ihm? Warum sprechen wir auch heute noch über Thomas?
Weil wir lieber wie die anderen Jünger wären: voller Glauben. Aber mindestens heimlich sind wir eher so wie Thomas. Der Zweifel nagt. Beweise sind rar. Die schriftlichen Zeugnisse sind alt. Die Geschichte der Bezeugung dieses Glaubens durch die Kirche ist voller Brüche.
Thomas hatte die Chance, seine Zweifel durch eine Begegnung mit dem Auferstandenen auszuräumen. Auch davon erzählt die Bibel. Sie will uns Mut machen, um zu vertrauen, um mit Thomas auch heute zu bezeugen: Der Herr ist auferstanden!
Glaubenssache:
Glaube und Zweifel
Von Prädikant Günther Dreisbach
Mit dem heutigen Ostersamstag geht die erste Woche nach Ostern zu Ende. Viele haben die Weite gespürt, die zwischen dem Karsamstag und dem Ostersamstag liegt, österliche Weite. Von der Enttäuschung über den Tod Jesu an Karfreitag, die Freude über die Auferstehung an Ostern bis zum Zweifel, ob das wirklich passiert ist, das mit Jesus. Oder war es ein Hirngespinst?
Am Sonntag nach Ostern geht es in den evangelischen und in den katholischen Predigten um Glaube und Zweifel. Es lohnt sich, zum Gottesdienst zu gehen und mit zu zweifeln, mit zu denken, mit zu hoffen und vielleicht dann auch mit zu glauben. Denn natürlich war das alles andere als normal, das mit Jesus von Nazareth. Klar, wir haben Ostern gefeiert und damit deutlich gemacht: Es ist wahr! Jesus ist auferstanden! Aber nach der Freude am Ostersonntag und in der Woche danach bis zum Ostersamstag sind doch auch Zweifel hochgekommen.
Im Evangelium des Sonntags zweifelt Thomas. Und es ist sein gutes Recht. Er kann das alles nicht begreifen. Und schon bald hat er seinen Namen weg: Thomas, der Zweifler. Einfach glauben, das geht nicht. Er ist ein Praktiker. Er will sehen, ob der, der ihm da gegenübersteht, auch der ist, den er als Jesus kannte. Geduldig lässt Jesus den Test über sich ergehen. Und dann glaubt Thomas.
Bin ich wie Thomas? Ich weiß es nicht. Manchmal schon. Und dann denke ich darüber nach, dass Jesus zu Thomas sagt: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Vielleicht gibt mir ja die Predigt von morgen nähere Erkenntnisse. Am besten, Sie gehen zum Gottesdienst und testen es. Gesegneten Sonntag!
30. März
Glaubenssache:
Leben
Von Pfarrer Johannes Heicke
In unserem Garten steht ein knorriger alter Apfelbaum. Die kahlen, vergreisten Äste recken sich zum Himmel wie in einem letzten Todesseufzer. Da ist keine Lebendigkeit, keine Bewegung, kein Grün. Wenn ich nicht schon erlebt hätte, dass Laubbäume jedes Jahr so tot aussehen, würde ich es nicht glauben: Da gehen doch tatsächlich an diesem alten, knorrigen Baum die ersten zarten Knospen auf, die ersten grünen Blättchen zeigen sich, die ersten weißen Blüten fangen an, sich zu entfalten!
Jesus hängt am Kreuz. Die Arme weit ausgestreckt nach seinem letzten Todesseufzer. Da ist kein Leben mehr, wirklich überhaupt keins. Sie nehmen ihn ab und legen ihn ins Grab. Drei Tage liegt er da, komplett tot.
Und dann kommt der Ostermorgen: Er ist wieder da! Er zeigt sich seinen Jüngerinnen und Jüngern. Die können es nicht recht glauben: Wie soll denn ein Grab leer sein? Wie soll denn jemand aus dem Tod wiederkommen? Das hat es doch noch nie gegeben! Immer wieder schwanken sie zwischen Glauben und Zweifeln hin und her, obwohl sie ihn vor sich sehen, ja sogar berühren: Kann das wirklich wahr sein?
Bis heute schwanken wir Christenleute zwischen Glaube und Zweifel hin und her. Und das, obwohl wir die Knospen, ja sogar die Blüten und Früchte des starken Baums sehen können, den wir Kirche, Leib Christi, nennen: Zwei Milliarden Menschen auf der Erde gehören dazu, und ihre Zahl wächst stetig! Sie tun Gutes in aller Herr:innen Länder, engagieren sich gegen den Hunger und für den Frieden, gehen auf die Straße gegen Rassismus und Gewalt. Woher nehmen sie diese Kraft? Sie bekommen sie vom auferstandenen Herrn Jesus: Er lebt!
23. März
Glaubenssache:
Eine stille Woche
Von Lektorin Maryam Parikhahzarmehr
Nein, nicht weil es Schulferien gibt, nennt man die Woche, die morgen beginnt, die »stille Woche«. Alles soll ein bisschen ruhiger laufen. Am Freitag gibt es sogar einen freien Tag. Ein Geschenk an alle, die Tag für Tag arbeiten. Und aus Dankbarkeit dafür geht man dann zum Gottesdienst. Was aber ist der Grund für die Dankbarkeit?
Die christlichen Kirchen denken in dieser Woche an das Leiden und den Tod Jesu. Und auch wenn manche Arbeitnehmer diesen freien Tag als eine soziale Errungenschaft ansehen: das ist er natürlich nicht. Der Tod Jesu – eine soziale Errungenschaft? Wer das glaubt, hat irgendwie nicht verstanden, um was es geht. Ich finde es gut, dass bestimmte Dinge am Karfreitag einfach nicht sein dürfen: Tanzveranstaltungen und Sportveranstaltungen zum Beispiel. Das kann man doch einmal aushalten, allemal dann, wenn man die Jahre nach dem zählt, dessen Tod man an diesem Tag gedenkt.
Jesus ist das Zentrum dieser Woche. Um ihn dreht sich alles. In den Andachten und in den Gottesdiensten und in den Abendmahlsfeiern. Wir bedenken, was er aushalten musste und was ihm die Machthaber seiner Zeit angetan haben. Und auch dann, wenn am nächsten Samstag, dem Karsamstag, Grabesruhe herrscht. Nein: Das ist noch nicht der Ostersamstag; der ist erst eine Woche später. Ordnung muss sein.
Das wär’s doch: Eine Woche in aller Stille denken an Jesus, der für uns als Christen der Weg ist, den wir gehen sollen, die Wahrheit, die wir weitersagen sollen und das Leben, auf das wir uns freuen. Aber das feiern wir dann Ostern. Das ist jetzt noch nicht das Thema.
16. März
Gedanken zum Sonntag:
„Frühjahrsputz“
Von Pfarrerin Johanna Fischer
Es geht los, hier und da wird schon der Lappen geschwungen, die Fenster geputzt, der Schrank ausgewischt, unnötiges aussortiert. Auch der Wintermantel darf langsam der Übergangsjacke weichen.
Im Garten wurden trockene Äste geschnitten und Blumen gepflanzt. Der erste Kaffee auf der Terrasse ist getrunken, ein Plausch am Gartenzaun gehalten, in Gedanken schon Feste für den Sommer geplant.
Noch haben wir Passionszeit, Fastenzeit. Manche nutzen diese Zeit für einen Frühjahrsputz der Seele. Sich von altem Ballast befreien, eigene Erwartungen anschauen und entstauben, Prioritäten setzen und Visionen erschaffen.
Was wollen Sie loslassen? Welche Erwartungen entstauben Sie? Worauf freuen Sie sich besonders? Was ist Ihnen wichtig geworden? Worauf hoffen Sie?
In zwei Wochen ist Ostern. Da feiern wir das Fest der Auferstehung Jesu. Ein Ausblick, der mir Hoffnung schenkt. Hoffnung auf Begleitung von einem, der den Tod durchschritt und uns lebendig macht. Hoffnung auf eine schöne Zeit mit Familie und Freunden. Hoffnung darauf, dass die Farben wiederkommen, in der Natur und in unseren Herzen und Köpfen. Manchmal sogar ganz ohne unser Zutun.
Glaubenssache
Von Pfarrer i.R. Ulrich Trzeciok
„Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt …“. Gut, heute nimmt er dafür den Traktor, aber an der Sache hat sich nichts geändert. Das Ackerland muss bestellt werden, damit die Samenkörner ausgesät werden können. Wenn nicht, wenn Unwetterkatastrophen oder Krieg es verhindern, dann können keine neue Pflanzen wachsen und reifen, dann gibt es nichts zu ernten, dann gibt es Hunger. Es ist gut, wenn die Traktoren jetzt nicht zu Demonstrationen auf den Straßen rollen, sondern auf den Äckern ihre Arbeit verrichten. Die eigentliche Arbeit freilich verrichten die Bauern und Bäuerinnen. Sie müssen von ihrer Arbeit existieren und leben können.
In einem Gleichniswort greift Jesus dieses Geschehen von Aussaat und Ernte auf, wenn er sagt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ (Joh 12, 20ff). Morgen, am 5. Sonntag in der Fastenzeit, wird es in der Liturgie der katholischen Kirche zu hören sein. Das verweist uns auf das Glaubensgeheimnis des Osterfestes: Das irdische Leben des Jesus von Nazaret sinkt in die Erde und stirbt – und ersteht zu einem neuen Leben als Jesus, der Christus. Er will auch uns in dieses neue Leben führen.
Bei denen, die ihm –bewusst oder unbewusst- auf diesem Weg folgen, sehen wir es ähnlich: bei Mahatma Gandhi. Gewaltlos ist er eingetreten für die Freiheit und Gerechtigkeit für sein indisches Volk. Oder bei dem Pastor Martin Luther King. Gewaltlos ist er aufgetreten gegen Rassenwahn und die Unterdrückung der „farbigen“ US-Amerikaner. Beide wurden ermordet, aber ihre Saat ist aufgegangen und hat gute Frucht gebracht. Wird es bei Alexej Nawalny in Russland auch so werden?
Ulrich Trzeciok ist Stadtpfarrer im Ruhestand und Geistlicher Rat aus Naumburg.
9. März
Gedanken zum Sonntag:
Wie geht’s dir wirklich?
Von Pfarrer Jonathan Bergau
„Na, wie geht's?“, fragt mich mein Nachbar. „Muss…“, sage ich und gehe schnell weiter. Ich möchte nichts erzählen von meiner dicken Erkältung. Von meiner Krankheit braucht der Nachbar nichts zu wissen. Ich möchte nichts preisgeben, möchte stark sein, alles selber schaffen. Dieses Bild möchte ich nach außen vermitteln.
Wäre es nicht schön, zu sagen was mir fehlt? Eigentlich möchte ich doch meine Verärgerung darüber auszudrücken, dass diese Krankheit mir jetzt so gar nicht in den Kram passt. Dann müsste ich aber vor meinem Nachbarn ehrlich sein. Kann ich einfach so zu ihm gehen? Erwartet er eine ehrliche Antwort von mir, wenn er fragt, wie es mir geht? Zu wem kann ich gehen?
Mir kommt ein Stück Bibel in den Sinn: „Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.“(Jes 53, 4) Das berichtet das Prophetenbuch Jesaja über den Knecht Gottes, der leidet. Im leidenden Gottesknecht sehe ich als Christ Jesus am Kreuz. Er führt mit vor Augen, dass nicht Stärke zählt. Nicht nur am Kreuz hält er das Leben aus. Auch in seinem Leben weicht er dem nicht aus, was dieses schwer macht. Jesus versteckt seinen Unmut über das Schwere in seinem Leiden nicht, am Kreuz schreit er sogar die Wut über sein Gott-verlassen-Sein heraus und begibt sich dann in Gottes Hände.
Darf ich also auch meine Schwäche zugeben – sogar vor meinem Nachbarn?
Bleiben Sie behütet Ihr Pfarrer Jonathan Bergau
Glaubenssache:
Danke fürs Vergessen
Von Pfarrer Martin Jung
Sie denkt an alles. Sie hat alles Blick. Im Büro, in der Familie, in der Freizeit – sie weiß ganz genau, wann was wo sein muss. Sie hat Listen, führt den Familienkalender und kleine Klebezettel erinnern sie an die wichtigsten Dinge. Doch jetzt ist es passiert. Sie hat ihre Freundin vergessen. Vor zwei Monaten hatten sie einen Termin zum Pizzaessen ausgemacht. Und sie wollte die Uhrzeit eintragen. Aber dann ging das im Stress des Alltags irgendwie verloren. Sie lag im Bett und ihre Freundin saß allein beim Italiener. Das Handy war aus und am Morgen kam das böse Erwachen: „Wo bist du?“, drei Anrufe in Abwesenheit. Und dann die Nachricht „Ich gehe jetzt heim. Danke fürs Vergessen.“
Fehler passieren. Die Welt und unser Leben sind komplex. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten unsere Lebenszeit zu füllen. Die Erwartungen im Beruf und Privatleben sind hoch. Termine und Absprachen vergessen, ist vorprogrammiert. Ich kann gar nicht alles schaffen und denke doch oft, ich könnte es. Und oft genug erwartete ich das auch von anderen. Wenn denen dann Fehler passieren, bin hart und unbarmherzig. Sie sind es ja schließlich auch mit mir. Ein Teufelskreis. Jesus sagte einmal: „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ Wer so lebt, der weiß: Vergessen und Vergessenwerden gehört zum Leben mit dazu. Fehler werden gemacht und müssen auch angesprochen werden, aber was kommt dann? Jesus sagt: Barmherzig sein. Es gut sein lassen. Vergeben und vergessen. Das bringt viel mehr. Das führt uns weiter, weiter in eine Welt mit mehr Herz und Liebe. So wie sie Gott sich gedacht hat. Dann klappt´s auch nochmal mit der Pizza.
2. März
Gedanken zum Sonntag:
Es gibt so viel, was man nicht muss
Von Pfarrer Simon Diederich
„Es gibt so viel, was man nicht muss.“ Ein Satz, der mich angesprochen hat. Ein Buchtitel, der für mich inmitten all der Bücher, die mir sagen, was ich alles muss, wohltuend anders klingt. Inmitten all der „101 Sachen, die du tun musst, bevor du stirbst“- Literatur. Die Vorstellung meinem Leben einen tieferen Sinn zu geben, indem ich jene 101 Biersorten trinke, die der Autor empfiehlt, oder jene recht beliebig ausgewählten 1001 Orte besuche, von denen der Autor mir weismachen will, dass mein Leben ohne einen Besuch dort sinnlos gewesen sei, schien mir schon immer etwas seltsam.
Tomas Sjödin, der schwedische Theologe und Autor der genannten Kolumnensammlung, versteckt hinter seinem Titel keine weitete Sammlung von „Du musst“-Sätzen. Ganz im Gegenteil.
Er legt in seinen Kolumnen dar, dass es gerade die Entzauberung und Vernichtung von vielen dieser „Du musst“- Sätzen ist, die uns wirklich guttut.
Es sind gerade die Situationen, in denen ich aufhöre, mich zusammenzureißen, in denen ich die Zügel aus der Hand gebe, es aufgebe all dem vermeintlichen Müssen nachzukommen, die einen wirklich voranbringen. Raum schaffen für Veränderung. Für Hilfe.
Raum für Gott und Raum für andere Menschen.
24. Februar
Gedanken zum Sonntag:
Mit Liebe gemacht…!
Von Gemeindereferent Peter Happel
Vor einigen Wochen habe ich eine selbstgemachte Mütze geschenkt bekommen. Meine Mutter überreichte sie mir mit den Worten: „Ich hoffe, dass du damit gut durch den Winter kommst“. Ich spürte, alles war mit Liebe gemacht und ausgesucht.
Mit Liebe gemacht war auch die Ausgabe des „Kirchenfensters“ für die Monate Dezember und Januar der evangelischen Stadtkirchengemeinde in Hofgeismar. Der Titel greift die Jahreslosung auf und hat mich nachdenken lassen über die vielen Kleinigkeiten, die Menschen, oft ungefragt, für mich erledigen.
Der Nachbar, der meine Tonne mit raustellt, weil ich es mal wieder vergessen habe. Oder wenn jemand für mich den Weg von Eis und Schnee freihält. Ohne diese Hilfen wäre mein Alltag wesentlich schwieriger. Ich will in den nächsten Tagen meinen Blick auf diese scheinbaren Kleinigkeiten richten und mich darüber freuen. Gehen sie doch mit mir auf Entdeckungsreise und kommen den kleinen Dingen des Alltags auf die Spur, für die Sie dankbar sind! Vermutlich werde ich nicht alle Aufgaben mit Liebe erledigen, die in der neuen Arbeitswoche anstehen aber versuchen kann ich es!
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag!
Peter Happel ist Gemeindereferent der katholischen Kirchengemeinde St. Peter in Hofgeismar.
Glaubenssache:
Wie geht Frieden?
Von Pfarrerin Katharina Ufholz
Ein Mann ging im Park spazieren. Da sah er, wie ein paar Kinder mit Stöcken aufeinander einschlugen. „Hört sofort auf!“, fuhr er dazwischen. Die Kinder versicherten ihm, dass sie doch nur spielten. Auf die Frage, was das für ein Spiel sei, bekam er zur Antwort: „Wir spielen Krieg.“ Energisch sagte der Mann: „Krieg, Krieg – ihr solltet lieber Frieden spielen!“ Die Kinder stutzten und legten die Stöcke beiseite. Als der Mann weiterging, folgte ihm einer der Jungen, zupfte an seinem Ärmel und blickte ihn fragend an: „Wie spielt man denn Frieden?“
Mit dieser Frage endet die Geschichte. Schade, denke ich mir. Ich hätte zu gerne gewusst, was die Antwort des Mannes gewesen wäre. Aber das offene Ende regt zum Nachdenken an.
In der Bibel sagt Jesus: „Selig sind, die Frieden stiften…“ In diesem Satz wird deutlich: Frieden muss mehr sein als nur die Abwesenheit von Krieg. Frieden darf nichts Unkonkretes bleiben, er muss mit Inhalt gefüllt sein. Frieden muss gelernt und gemacht werden.
Der wichtigste Lernort ist sicher das Zuhause. Im besten Fall bekommen Kinder hier vorgelebt, wie man streitet und sich wieder verträgt, wie man Empathie und Mitgefühl zeigt. In Kindergärten und Schulen gibt es pädagogische Programme, die Kindern „Handwerkszeug“ für einen friedlichen Umgang miteinander auf den Weg geben. All das ist wichtiger denn je.
Heute jährt sich der Kriegsbeginn in der Ukraine zum zweiten Mal. 731 Tage Krieg sind 731 Tage zu viel! Wie dringend brauchen wir hier und in all den anderen Kriegen und gewaltsamen Konflikten eine Antwort auf die Frage: Wie geht Frieden?
17. Februar
Gedanken zum Sonntag:
Das Größte? – Die Liebe!
Von Pfarrerin Dr. Gabriele Kölling
Der 14. Februar ist Valentinstag. Schon im Jahr 496 wurde er in der katholischen Kirche als Gedenktag des heiligen Valentin in den Kalender aufgenommen und 1969 wieder gestrichen.
Warum, weiß ich nicht. Auch nicht, ob es diesen Valentin überhaupt gab. Da gehen die Meinungen auseinander. Diejenigen, die behaupten, dass er gelebt hat, erzählen sich, dass er Menschen getraut hätte, denen das Heiraten verboten war. Dass die evangelische Kirche den Valentinstag für sich entdeckt, ist eher neu.
Am 14. Februar laden wir Paare zu Gottesdiensten ein und segnen sie. Verheiratete, liierte, jung Verliebte und Paare mit einer längeren Liebesgeschichte. Warum? Weil es ein großes Glück ist, einen Menschen zu finden, den man liebt und mit dem man das Leben teilen kann. Das ist nicht selbstverständlich und machbar sowieso nicht. Es ist ein Geschenk, zum Freuen und zum Hegen und Pflegen. Gottes Geschenk. Am Valentinstag haben wir in der vergangenen Woche Paare in die Brunnenkirche eingeladen. Wir haben ihnen die Hände aufgelegt und gesagt: „Gott segnet und beschützt eure Liebe. Vertraut ihm!“
Falls Sie den Valentinstag in diesem Jahr verpasst haben, denken Sie dran: das gilt auch für Sie. Feiern Sie Ihre Liebe, immer wieder! Es gibt nichts Größeres.
Glaubenssache:
Geiersbach geht
Von Ursula Muth
Haben Sie „Soziale Energie“? Klar! Haben Sie!
Du raffst dich abends - leicht erschöpft - noch einmal auf, zu einer Chorprobe, einem Kinobesuch, … und kommst dann aber munter wieder zurück. Das nennt der Soziologe Hartmut Rosa „Soziale Energie“. Diese Energie müsse man nicht erst irgendwo tanken und die verliere man auch nicht bei gewissen Aktivitäten. Sie kommt aus diesen Aktivitäten selbst. Unser Kirchenmusiker Bernd Geiersbach wird an diesem Sonntag verabschiedet. Wie viel Lebensenergie mag er in seinen 36 Dienstjahren aktiviert haben? Allein das unglaubliche Finale in der Weihnachtszeit dieses Jahres mit 411 Beteiligten und tausenden Gästen hat diese Lebensenergie, die in uns allen steckt, vielfach wachwerden lassen. Allein der Gedanke an die Szene, in der von allen Seiten Engel zwischen drei und 70 Jahren in weiß strahlenden Gewändern zur Krippe vorn in der Kirche flatterten, erheitert mich noch heute.
Es sind die „guten Mächte“, die uns treu und still umgeben. Sie stecken in den Erfahrungen von Musik, Literatur und Gemeinschaft, die viele von uns seit der Kindheit in Familie und Kirchengemeinde prägen. Längst ist erwiesen, wie gesund Singen ist – vor allem im Chor. „Soziale Energie“ sei eben „keine individuelle Ressource, sondern eine kollektive Kraft“, so Hartmut Rosa. Sie entstehe direkt in ihrer Verausgabung. Ob diese „Soziale Energie“ auch mit „Heiliger Geist“ zu übersetzen ist?
Wir brauchen die Kirchenmusik, wir brauchen das Singen, die Literatur und die Gemeinschaft. Ich finde das in Gottesdiensten – und im anschließenden Gespräch, von klein auf.
10. Februar
Gedanken zum Sonntag:
Gute Freunde
Von Vikar Philipp Rennert
„… kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein.“ So sang der erst kürzlich verstorbene Franz Beckenbauer, der Kaiser, im Kreise seiner Freunde und Mitspieler.
Gute Freunde sind nie allein, trotz schwerer Zeiten. Danach sind sie im besten Fall immer noch füreinander da. Wir Christen begehen diese Woche als Vorbereitung auf die anstehende Passions- und Fastenzeit. Eine Zeit, in der sich das Leben Jesu und seiner Anhänger zuspitzt: Er zieht mit ihnen in Jerusalem ein. Es gibt Auseinandersetzungen auf dem Markt und im Tempel. Die Menschen sind verunsichert. Jesus ahnt sein Schicksal: Er wird denunziert, verklagt, zum Tode verurteilt. Freund Petrus wird ihn verleugnen. Trotzdem geht Jesus auf schwere Zeiten zu, ohne die Flucht zu ergreifen. Jesus, kein Kaiser, für manche aber ein König, spielt mit. Er vergibt allen, auch dem Freund.
An manchen Momenten weiß ich, da steht mir noch was bevor! Life goes on, auch in Erwartung einer eigenen schweren Phase, die ich durchlaufen muss. Herausfordernde Zeiten sind eine Bewährungsprobe für Freunde. Bin ich allein? Nein. Ich glaube, ich bin es nicht. Ob ich über meine Sorgen singe oder spreche, es kommt jemand und wird mit mir die Worte teilen. Es ist Zeit für gute Freunde.
Glaubenssache:
Hörst du nicht die Glocken?
Von Pfarrer Karl-Alfred Dautermann
An Silvester las ich in meinem Andachtsbuch: „Um Mitternacht werden in vielen Kirchen die Glocken läuten. Ob man es hören kann, wenn die Silvesterraketen mit Pfeifen und Knallen in den Himmel steigen? Doch die Glocken werden klingen und dem Übergang vom alten zum neuen Jahr eine Grundmelodie geben: In Höhen und in Tiefen sind wir von Gott begleitet.“
Das hat mich gepackt und neugierig gemacht. Die schwerste Glocke Deutschlands ist mit 24 Tonnen der „Dicke Pitter“ vom Kölner Dom, wow. Für den Aufzug der 3,22 m breiten Glocke musste 1924 das Portal des Doms ausgebaut werden. Ein „LKW“ im Glockenturm! - Die älteste Glocke hängt in Bad Hersfeld und ist fast tausend Jahre alt. - Las ich doch auch, dass viele Glocken eine Inschrift tragen: O Land, Land höre des Herrn Wort. (Jeremia 29,22) Das wär´ doch mal was, mit jedem Glockenschlag dringt die Liebe Gottes in unsere Herzen und wird von uns weitergetragen. Dann sähe unsere Welt aber anders aus.
Hörst du nicht die Glocken? Wann haben sie das letzte Mal die Glocken vom Kirchturm bewusst gehört? Als Zeitgeber haben sie ja längst ihre Bedeutung verloren. Aber als Boten der Liebe und des Trostes Gottes aus der Höhe, da taugen sie immer noch, egal was wir Menschen tief unter ihnen anstellen und uns ausdenken. Denn die Grundmelodie bleibt: In Höhen und in Tiefen sind wir von Gott begleitet. Verlassen sie sich drauf! Und hören sie auf sein Wort, morgen wieder im Gottesdienst!
3. Februar
Gedanken zum Sonntag:
Wo ist Liebe in der Welt?!
Von Pfarrer i.R. Karl Christian Kerkmann
Bei dem Wort Liebe denke ich an das Bibelwort:
Gott ist Liebe - und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm!
Wo ist Liebe in der Welt? Viele sagen: Liebe, ja… schon…, aber: schau da, schau da … Gegeneinander statt Miteinander, Verurteilung, Hass, Krieg, Lieb-Losigkeit in allen Varianten „Liebe, ja … aber“! Das möchte ich mal „Aber-Glauben“ nennen!!
Denn: wenn wir nur darauf schauen, auf dieses Aber, dann werden wir abgelenkt von unserer Bestimmung als Christen: nämlich Liebe zu sein – Ausdruck der Liebe Gottes in dieser Welt!! Als bewussten Gegenpart in dieser vielfach so lieb-losen Welt. Das ist unsere große und wunderbare Aufgabe!!
Ganz konkret wird das in einem Lied beschrieben:
Singt von Liebe in der Welt dort, wo Menschen hassen,
wo auf Macht, Besitz und Geld alle sich verlassen,
wollen wir in allem Tun uns auf Christus gründen.
Singt von Liebe in der Welt, lasst von ihr uns künden!
In einem Lied des Gospelchores Hofgeismar, wo ich sehr gerne mitsinge, heißt es:
Brücken bauen dort, wo Gräben sind.
Hände reichen nach dem langen Streit.
Hoffnung säen, bis der Friede blüht.
Augen öffnen, Gott im Andern sehn …
Und darum gilt: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“, wie es die Jahreslosung 2024 sagt.
Glaubenssache:
Unmögliches vor dem Frühstück
Von Pfarrerin Isabell Paul
„Etwas Unmögliches kann man nicht glauben“, sagt Alice.
„Du wirst darin eben noch nicht die rechte Übung haben.
Zuzeiten habe ich vor dem Frühstück bereits bis zu sechs unmögliche Dinge geglaubt.“, sagt da die Königin zu Alice im Wunderland in Lewis Carrolls Roman.
Und weil ich vielleicht auch noch nicht die rechte Übung habe, hier mein Versuch.
Was könnten heute noch alles für Wunder geschehen?
Es könnte doch sein…
… Du triffst schon ein Schneeglöckchen, das Dir sagt: Es wird nicht für immer Winter sein.
… die Wolken am Himmel melden sich für einen ganzen Tag krank und die Sonne kommt gar nicht mehr raus aus dem Strahlen.
… einer verschenkt heute warmes Essen und es reicht für viele mehr als gedacht.
… die Diagnose lautet: Gesund!
… Oma winkt einmal kurz aus dem Himmel, nur damit Du weißt, alles ist gut.
… eine beginnt zu sehen, dass es großartig ist, dass er so anders ist als sie und andere machen mit.
An unmögliche Dinge zu glauben, macht mir Hoffnung für die Welt, in der wir leben. So lässt sich die Welt – und ja auch mein Leben – aus einer anderen Perspektive betrachten. Es könnte doch sein, dass heute etwas Positives geschieht und vielleicht wirkt schon diese Haltung Wunder. Ich jedenfalls glaube, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als wir sehen und begreifen können. Eine Kraft – ich nenne sie Gott – die mir in dieser Welt das Vertrauen schenkt, dass es hier nicht aussichtslos ist. Egal, ob du da mitgehen kannst oder nicht, ich finde, es kann doch nichts schaden darauf zu hoffen, dass heute noch ein Wunder geschieht.
Also: An welche unmöglichen Dinge glaubst Du heute?
27. Januar
Gedanken zum Sonntag:
Worte und Wörter
Von Pfarrer Andreas Schreiner
Wir Menschen reden und erzählen gern, wir lesen und hören gern anderen zu. Zu alten Zeiten war das direkt gesprochene Wort die einzige Form der Kommunikation, aber Zeitungen gibt es seit Jahrhunderten, Talkshows im Fernsehen sind seit vielen Jahren eine Garantie für feste Einschaltquoten., seit es die sozialen Medien gibt, kommen da auch Podcasts dazu oder die Tweets auf X (vormals Twitter), WhatsApp und Facebook und so weiter.
Worte strömen täglich zu zehntausenden auf uns ein, werden dabei von Worten zu bloßen Wörtern, die wir gelernt haben bewußt oder unbewußt zu überhören. Dabei haben können Worte mächtig sein. Sie beeinflussen unsere Gefühle, ändern unser Denken und bestimmen unser Handeln. Manche Worte sind besonders.
Gottes Wort wird uns überliefert in der Bibel. Seit über 40 Jahren gibt es den ökumenischen Bibelsonntag am letzten Sonntag im Januar, seit einiger Zeitmzusammen mit den katholischen Sonntag des Wortes Gottes. „Gottes Geschöpf - Geschenk und Verantwortung“ ist in diesem Jahr das Leitwort.
Gottes Wort in der Heiligen Schrift verbindet alle Christen auf der ganzen Welt. Lassen wir es in der Wörterinflation nicht untergehen.
Glaubenssache:
Warten
Von Lektor Günter Schnellenpfeil
Worauf wartest du? Auf die baldige Beendigung der Kriege im nahen Osten und der Ukraine? Oder ganz banal: auf Möbel oder auf eine Paketlieferung?
Ganz anders ergeht es Simeon, einem alten u. erfahrenen Christen, der auf die Zusage Gottes wartet. Dieser hatte ihm versprochen, dass er den angekündigten Heiland und Erretter Israels, mit den eignen Augen sehen würde, bevor er sterben werde. Nun da er oft in den Tempel geht, begegnet er eines Tages auch Josef & Maria mit dem Jesuskind.
Simeon erkennt sofort in diesem Kind, den von Gott angekündigten Messias. Mit den Augen des Glaubens sieht er den weiteren Weg von diesem Kind Jesus: Er heilt Lahme u. Blinde. Menschen erfahren Vergebung u. neues Leben. Das Gewaltigste aber bleibt, dass dieser Jesus für dich und mich, sich ans Kreuz schlagen lässt. Nach drei Tagen hat er den Tod besiegt, damit wir die Chance haben, ewig bei ihm zu leben.
Simeon kann gar nicht anders, als das bekannte Loblied anzustimmen: Herre, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, … (Lk.2, s. ab v 25 ff). Hier spürt Simeon wirklichen Halt und Geborgenheit. Er spürt, dass das Warten auf die Zusage Gottes gelohnt hat. Du merkst, dass Warten kann sehr unterschiedlich sein. Wir dürfen wie einst Simeon auf Jesus schauen, den nun erhöhten u. mächtigen Herrn. Ihm unser Herz öffnen und ihn bitten, heilsam in unserem Leben und in der Welt zu wirken.
20. Januar
Gedanken zum Sonntag:
Liebe die keinen Spaß macht
Von Arno Backhaus
Für 2024 lautet die Jahreslosung in unseren Kirchen "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe". Wussten Sie, dass es eine Steigerung von Liebe gibt? Jesus sagt in Joh. 15 „Niemand hat eine größere Liebe, als der der sein Leben für seine Freunde hingibt.“, d.h. aber, es gibt auch eine niedrigere Liebe.
Das alles kann Liebe sein in unterschiedlicher Intensität und Steigerung: Wenn ich einer älteren Dame die Türe im Laden aufhalte; wenn ich einen Behinderten über eine stark befahrene Straße verhelfe; wenn ich 1000 € spende für Amnesty International; wenn ich Zeit investiere für ein Ehepaar, die Konflikte miteinander haben; wenn ich jemanden wochenlang helfe beim Umbau seines Hauses; wenn ich ehrenamtlich mich bei der Tafel engagiere; wenn ich meiner Frau im sexuellen Bereich näherkomme.
Die größte Liebe, sagt Jesus, ist, wenn ich mein Leben riskiere, z.B. in dem ich versuche jemand zu retten der im Eis eingebrochen und am Ertrinken ist. Die macht aber doch keinen Spaß. Mutter Teresa hatte doch, als sie noch lebte, keinen Spaß, als sie in den Slums von Kalkutta sterbende Menschen versorgte? Auch Jesus hatte keinen Spaß, als er vor lauter Liebe für uns am Kreuz gestorben ist. Liebe hat ein Ziel, ist Aktion, nicht Reaktion, kein Ergebnis und Verdienst. Liebe kann schwierig sein.
Ich wünsche Ihnen im neuen Jahr die Kraft „von oben“, wenn sie gegen ihre Gefühle trotzdem lieben…
13. Januar
Gedanken zum Sonntag
Von Pfarrer Andreas Kölling
Am 7. Januar ist Franz Beckenbauer gestorben. Damit ist vielleicht der größte des deutschen Fußballs von uns gegangen. Wir wissen heute auch um seine Fehler. Dennoch ist da noch genug, dass wir bewundern und zu dem wir aufschauen können.
Wir normalen Menschen scheinen da irgendwie zu schrumpfen. Der „Kaiser“ zeigt uns unser Normalmaß. Das haben schon früher die Mitspieler in seiner Mannschaft so empfunden. - Doch es gibt auch das Gemeinsame, was jeden von uns mit Franz Beckenbauer verbindet: Er wuchs wie viele in einem Arbeiterviertel auf. Er hat gezeigt, wie wichtig Fleiß und Ehrgeiz sind, auch wenn man noch so talentiert ist. Darin ist er ein Vorbild.
Ein Vorbild kann er uns auch sein in seinem Glauben an Gott. Gott und Kirchgang waren für ihn selbstverständlich. Und einmal hat er auch erklärt: „Ich bete jeden Tag das Vaterunser. Es hilft mir, die täglichen Herausforderungen zu bewältigen und für meine Familie da zu sein. Es ist für mich das Gebet der Gebete, es gibt mir Kraft und Stärke.“ Das auch ein „Kaiser“ die Hände gefaltet und sich vor Gott gebeugt hat, finde ich sehr sympathisch. Er hat Gott um Kraft und Stärke gebeten. Und mit Blick auf sein Lebenswerk können wir wohl sagen: Franz Beckenbauer hat sie auch bekommen.
Glaubenssache:
Widerständige Nachfolge
Von Pfarrer Lars Bachmann
Was haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den vergangenen 10 Jahren erlebt und getan? – Was sind schon 10 Jahre, mögen Sie vielleicht fragen? Eine lange Zeit im Leben eines jeden Menschen, so schreibt es der Theologe Dietrich Bonhoeffer vor 80 Jahren an Freunde. Im Rückblick fragt er sich, ob es verlorene, unaufgefüllte, leere Zeit war. In seinem immer noch lesenswerten Buch „Widerstand und Ergebung“ legt er Rechenschaft darüber ab, dass es keine verlorene Zeit war, auch wenn Vieles, Unermessliches verloren gegangen ist.
Es ist zwar für ihn eine Gnade vergessen zu können. Aber vor allem das Gedächtnis, das Wiederholen empfangener Lehren befähigen seiner Meinung nach zu einem verantwortlichen Leben im Angesicht der Maskerade des Bösen, die nicht nur unsere bequemen Gewohnheiten sondern auch ethische Begriffe durcheinander wirbelt.
In solchen Zeiten konnte er sogar für sich formulieren: „Ich glaube, dass mir nichts Sinnloses widerfährt und dass es für uns alle gut so ist, wenn es auch unseren Wünschen zuwiderläuft. Ich sehe in meinem gegenwärtigen Dasein eine Aufgabe und hoffe nur, dass ich sie erfülle. Von dem großen Ziel her gesehen sind alle Entbehrungen und versagten Wünsche geringfügig.“
Von diesem Geist der widerständigen Nachfolge brauchen wir mehr in Tagen wie diesen! Wir brauchen Widerstand, wo Leben und Freiheit bedroht werden, und Ergebung in die Nachfolge Christi, der uns auf den Weg der teuren Liebe stellt. Das können wir, weil gilt: Wir sind „von guten Mächten treu und still umgeben behütet und getröstet wunderbar“.
6. Januar 2024
Gedanken zum Sonntag:
All You need is love?
Von Pfarrer Markus Schnepel
"Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe!", heißt der Spruch aus der Bibel, der viele Menschen in diesem Jahr 2024 begleitet. Noch bin ich erfüllt von schönen und sehr gut besuchten Gottesdiensten an Weihnachten und zum Jahreswechsel. Mit dem Schwung geht das gut. Und so sollte es ja auch sein. Da sind wir uns sicher alle einig. Aber ist das im Alltag nicht nur ein frommer Wunsch?
Mir selber gelingt das mal besser, mal schlechter. Ich rufe eine ältere Freundin an, die sich riesig freut, dass ich mal wieder zum Tee vorbeikommen möchte. Gut gemacht! Ich schnauze den Mitarbeiter einer Hotline an, weil ich einfach die Geduld verliere, da niemand sich um mein Anliegen kümmern möchte. Das war lieblos.
Gut, dass es in der Bibel nicht einfach darum geht, dass ich ein bisschen lieber sein soll, 2024. Das würde wohl zu den Vorsätzen gehören, die sich in wenigen Wochen wieder erledigt haben. Gott liebt uns so sehr, dass er an Weihnachten ein kleines Menschenkind wurde und direkt an unserer Seite ist. Wenn ich dem vertraue, zieht die Liebe in mein Leben ein. Dann kann ich lieben und auch verzeihen. Auch mir selbst.
Das wird uns helfen im neuen Jahr. Im Kleinen und im Großen. So wünsche ich Ihnen ein liebevolles Jahr 2024!
Glaubenssache:
Alles in Liebe
Von Pröpstin Wienold-Hocke
Alles wird besser, wenn es mit Liebe geschieht. Wenn ich sanft geweckt werde und gnädig in den Spiegel schaue, ist der Tag mein Freund. Der Kaffee ist ein Genuss, und es interessiert mich wirklich, wie es der Kollegin am Morgen geht. Liebe im Alltag bringt das Beste zum Vorschein, in den Menschen und in den Dingen.
"Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen" - mit dieser Losung kann das Jahr 2024 gut losgehen. "Sei liebevoll, und sei liebevoll auch zu dir selbst." Achtsam, freundlich und zugewandt sein kostet kein Geld und oft nicht einmal mehr Zeit, aber es verträgt keinen Druck. Und die Liste der Aufgaben und Vorsätze ist lang.
Der Bibelvers für 2024 stellt eine Frage an den Kalender. Kann ich alles das, was ich mir vornehme, wirklich in Liebe tun? Oder muss ich Termine streichen, wenn ich zugewandt sein will? Weniger ist mehr, wenn die Dinge in Liebe geschehen sollen. Für Viele, besonders für Frauen in Familienverantwortung, ist die Überlastung ein alltägliches Problem, das sie allein nicht lösen können. Sie brauchen helfende Hände, damit sie nicht ausbrennen.
Die Liebe zu den Dingen des Alltags gehört nicht auf die To-Do-Liste. Liebevoll sein kann ich ein-üben, aber ich kann es nicht erledigen. Die Liebe ist eine Kraft, die vom Geben und Nehmen lebt, sie ist Gottes schöpferische Kraft. In vielen kleinen und großen Menschen und Dingen kommt sie mir im Alltag freundlich entgegen. Dafür will ich mir Zeit nehmen, ich will mich berühren und in Anspruch nehmen lassen von dieser Liebe, von Gottes Segen. Vor allen Dingen lasst die Liebe geschehen! Ein neues Jahr voller Liebe wünsche ich ihnen, liebe Leserinnen und Leser!


.jpg/picture-200?_=170498277a0)

_1.jpg/picture-200?_=1704981cbc0)

.jpg/picture-200?_=17b71f12028)
.jpg/picture-200?_=17049809340)

.jpg/picture-200?_=176714bed10)




.jpg/picture-200?_=17fc512a9a8)
.jpg/picture-200?_=17149614660)

.jpg/picture-200?_=17da44fcce8)

_1.jpg/picture-200?_=174a02d9d10)